Selten hat ein Autor die Stimmung seines Romans treffender in einem einzigen Begriff verdichtet als Maxim Biller hier mit: Die „Katschmorian-Gefühle“.
Bei der Person dieses Namens handelt es sich um den „schönen, fröhlichen armenischen Großvater“ des Ich-Erzählers „und obwohl er es sich nach Mamas Worten nie anmerken ließ, dachte er genauso oft an Selbstmord wie andere Leute an Liebe und Essen“. Niemand tut sich jedoch im Buch Gewalt an und aufhängen möchte man sich nach der Lektüre auch nicht, im Gegenteil!
Dafür macht sie erstens klar, wie sehr uns allen die Herkunft in den Klamotten hängt und wieviel zweitens die eigene Kindheit und der Ort, an dem man aufwuchs, mit dem Gefühl von Heimat zu tun haben. Eben jene „Mama“ fragt sich Zeit ihres Lebens, ob es richtig war, Anfang der 1970er Jahre mit dem Ehemann die Sowjetunion für immer zu verlassen: „Bis heute quält mich mein schlechtes Gewissen (…), dass ich nicht zu Papa vor seinem Tod nach Odessa geflogen bin.“ Eben jener Ehemann stand damals als politischer Aktivist und wegen seiner Pläne, nach Israel auszureisen, unter Beobachtung – Verhöre und spekulativer Anschlag inklusive.
Unter den vielen ironischen Wendungen im Schicksal der Familie stechen zwei heraus. Während die Mutter nach der Flucht in die Bundesrepublik viele Jahre für einen kommunistischen Professor arbeitet, schafft es der Vater nie in den Nahen Osten, heiratet allerdings nach der Scheidung die Tochter eines hochrangigen Nazi-Funktionärs. Kein leichtes (psychologisches) Päckchen also, das der Ich-Erzähler mit sich zu tragen hat, aus dem er als Schriftsteller aber auch handfesten Nutzen zieht.
Neben dem zeithistorischen Hintergrund schildert Biller in „Mama Odessa“ das Thema Migration aus der Sicht von Auswanderern und was sie hinter sich lassen. Eine interessante Perspektive – und heute aktuelle denn je.
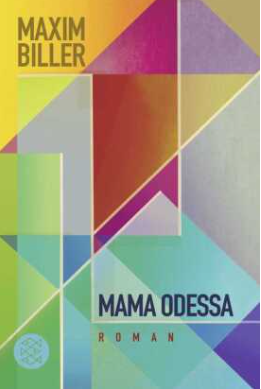
Foto: Verlag